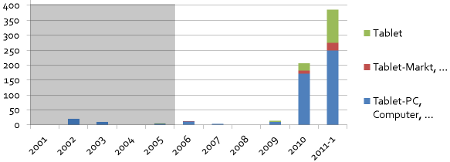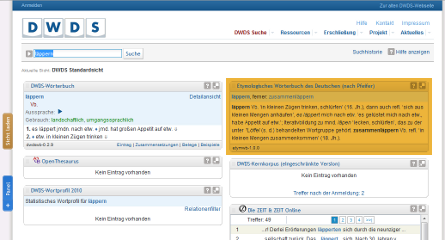Nebenan im Sprachlog hat Anatol unter dem Verdacht der Inhaltsleere die Frage gestellt, was seine LeserInnen so in welchem Kommunikationskanal siezen. Das hat mich dringendst daran erinnert, dass ich seit Jahr und Tag mal was zum ‘Siezen im Englischen’ schreiben wollte.
Das kommt so: Mit zunehmender Dauer tendiert die Wahrscheinlichkeit gegen 1, dass jemand in einer Diskussion zur Anrede im Englischen behauptet, dass im Englischen “streng genommen” nur gesiezt wird: Das “You” ist kein “Du”, sondern ein “Sie”, Die Du-Form … ist schon seit 200 Jahren aus dem Wortschatz verschwunden oder Das Englische “you” bedeutet nicht “Du”, sondern entspricht eher einer Anredeform, die der altdeutschen Form “Ihr” näherkommt, einem Plural, der Respekt bezeugt.
Obwohl sprachhistorisch nicht völlig daneben, ist die Begründung um und bei immer die Gleiche: Zu grauer Vorzeit gab es thou für die 2. Person Singular und you für die 2. Person Plural. Erstere (thou.2SG) sei dabei verloren gegangen und nur you.2PL ist übrig geblieben. Ergo: Im Englischen wird eigentlich gesiezt.
Das ist aber gleich ein dreifacher Trugschluss. Der erste Trugschluss, an dessen heißen Punkten ich mir gar nicht die Finger verbrennen will, ist der, dass die Anredestrategien in beiden Sprachen irgendwie eins-zu-eins aufeinander übertragbar wären. Der Trugschluss beschreibt die Vorstellung, dem deutschen Siezen im Englischen eine Entsprechung gegenüberstellen zu können. Dass das Unsinn ist, kann jeder bestätigen, der beide Sprachen auch pragmatisch ganz gut beherrscht und einem Monolingualen die Anredekonventionen der jeweils anderen Sprache erklären möchte. Natürlich könnte man argumentieren, dass man an der Verwendung von Vornamen oder Nachnamen eine gewisse Duzen-Siezen-Äquivalenz erkennen kann. Das Problem ist aber deutlich zu vielschichtig und ich möchte mich hier nicht im Dickicht verheddern, das versucht, ein zweidimensionales morphosyntaktisches Paradigma eindeutig auf ein mindestens vierdimensionales System von Distanz, Respekt, Kontext und soziokulturellen Normen anzuwenden. Darum soll’s mir hier nicht gehen.
Der zweite Trugschluss ist morphosyntaktischer Natur. Richtig ist zunächst, dass formal nicht zwischen you.2SG+V und you.2PL+V unterschieden werden kann. Das ist jetzt natürlich wenig erstaunlich, denn die einzige Präsensverbalflexion des Englischen findet sich in der 3. Person Singular Indikativ (zumindest in der Standardvarietät und mit Ausnahme von {BE}).
Dieser Trugschluss suggeriert aber, dass im Englischen die Zeile ‘2SG’ leer ist, was natürlich nicht stimmen kann (mehr dazu später). Wenn wir jetzt mal die soziolinguistische Siezen-Duzen-Unterscheidung weglassen, gibt es auch im Englischen die semantische Unterscheidung you ‘du’ und you ‘ihr’ — you ist da im Vergleich zum Deutschen ambig; aber immerhin.
| 1SG |
I |
am |
|
ich |
bin |
| 2SG |
you |
are |
|
du |
bist |
| 3SG |
he/she/it |
is |
|
er/sie/es |
ist |
| 1PL |
we |
are |
|
wir |
sind |
| 2PL |
you |
are |
|
ihr |
seid |
| 3PL |
they |
are |
|
sie |
sind
|
(Wenn wir’s also wirklich streng nehmen würden, ist Siezen schon allein deshalb Unfug, weil you.PL natürlich ‘ihr’ entspricht. Aber sind wir mal nicht so.)
Was verloren gegangen ist, ist die grammatische Unterscheidung von 2SG und 2PL, nicht eine 2SG-Form an sich. Die folgende Darstellung der historischen Entwicklung ist stark vereinfacht, nichtzuletzt, weil nur die Nominativ-Formen angegeben sind und hier noch der Dual aus dem Altenglischen ausgeklammert ist (Smith 1999: 77, 113, 146):
|
AE |
ME |
FNE |
ModE |
ModE (dialektal/
kontextuell) |
| 2SG.NOM |
þu |
thou |
thou |
you |
you/thou (arch.) |
| 2PL.NOM |
ge |
ye |
ye/you |
you |
yous(e)/yiz/yez |
An dieser kurzen Übersicht ist relativ klar erkennbar, dass you [ju:] die ‘Weiterentwicklung’ des 2PL-Pronomens ist und der Bruch beim 2SG-Pronomen im Frühneuenglischen (FNE) liegt. Die Erklärung geht so: <g> wurde im Altenglischen (AE) prävokalisch [j] ausgesprochen und <þ> als [ð], wie im heutigen they. Aber es bedeutet eben nicht, dass die 2SG-Form an sich verschwunden ist — die ältere Form thou wurde nach einer ziemlich komplexen Variation im thou/you-Kosmos von you verdrängt, welche dabei vom Plural-Kontext auf den Singular-Kontext ausgeweitet wurde und die Funktion you.2SG ‘du’ übernahm. Die Gründe dafür finden sich vor allem im stilistischen und soziopragmatischen Bereich (Busse 2002). Die ganze Geschichte ist in Wahrheit z.B. in Verbindung mit dem vorangegangenen Kasusabbau sehr viel komplexer, aber für den Moment soll das reichen.
Hier können wir ein Konzept aus der Sozilinguistik ins Spiel bringen, die sogenannte T-/V‑Unterscheidung (Brown & Gilman 1960). Anders ausgedrückt: thou hat früher nicht nur eine Numerusunterscheidung ermöglicht (2SG), sondern auch als T‑Pronomen fungiert (von lat. tu ‘du’), you/ye dagegen als V‑Pronomen (von lat. vos ‘ihr/Sie’). So gab es ein Honorifikum, mit dem man auch nur eine Person ansprechen konnte, also zusätzlich zu du/ihr auch eine entsprechende du/Sie-Unterscheidung treffen konnte — die sogenannte T-/V‑Unterscheidung. Diese Unterscheidung existiert im heutigen Englisch aber nicht mehr — und you erfüllt als you.2SG die Funktion ‘eine mir gegenüberstehende Person’ und als you.2PL ‘zwei oder mehrere mir gegenüberstehende Personen’.
Wenn jetzt also jemand sagt, im englischsprachigen Raum wird “eigentlich” gesietzt, der sagt damit ja, dass die Kategorie 2SG ungenutzt dastünde (s.o.). Dass das nicht richtig ist, zeigt sich erstens in der Numerusunterscheidung der Reflexivpronomina, wo yourself.2SG und yourselves.2PL klar die Existenz der Numeruskategorie belegen. Zweitens tritt you.2PL dialektal, kontextabhängig und umgangssprachlich als yous(e)/yez/yiz.2PL auf und ermöglicht so eine Disambiguierung von you.SG und you.PL. Wenig überraschend finden sich alle Belege für yous(e), youz(e), yiz, oder yez im BNC dementsprechend in den Genres der gesprochenen Sprache wie ‘Fiction’, ‘Oral History’, ‘Interview’ oder ‘Conversation’.
Ironischerweise ist eine mögliche Erklärung für das Verschwinden des thou.2SG aus dem Pronominalparadigma der Standardsprache, dass man zu Shakespeares Zeiten you.2PL (damals V‑Form) in einer Höflichkeitsspirale auch für Anreden nutzte, für die man bis dahin die T‑Form thou nutzte. Die Ironie dabei ist, dass thou jetzt archaisch ist und abgesehen von wenigen Dialektverwendungen heute auf religiöse und erzkonservative Kontexte beschränkt ist: Thou, my Lord! ‘Du, mein Gott’, also gewissermaßen jetzt eine höhere Formalität aufweisen. Der Prozess in der Standardsprache war aber um 1700 abgeschlossen, you der unmarkierte Fall für die allgemeine Anrede und die syntaktische V-/T‑Unterscheidung somit weggefallen (Busse 2002: 3, OED).
Der dritte Trugschluss ist deshalb etymologisch. Nur weil etwas irgendwann (hier: so vor, hm, 300–400 Jahren) mal so und so war, heißt das nicht, dass es noch so ist bzw. dass es noch so sein sollte. Heute wird gibt es im Englischen keine grammatische V-/T‑Unterscheidung. Selbst die dialektale Verwendung von thou ist auf einen sehr intimen-familiären Kontext beschränkt. Wenn, dann werden Distanz, Respekt oder sonstige Hierarchieungleichheiten auf andere Weise ausgedrückt. Aber gesiezt wird hier bestimmt niemand.
(Genauso dämlich ist es umgekehrt zu behaupten, im Englischen gäbe es kein Sie. Sollten Sie das aus meinen Zeilen lesen oder gelesen haben, gehen Sie zurück zu Trugschluss 1 und 2.)
Ach so ja: Die Großschreibung der Anrede Sie im Deutschen ist irgendwie auch nur eine schriftsprachliche Konvention, die zum Beispiel das strafrechtliches Beziehungsgeflecht bei ich wurde von Ihnen/ihnen krankenhausreif geschlagen disambiguiert. Hände hoch, wer beim siezen an eine abwesende dritte Person im Plural denkt? Morphosyntaktisch nutzen wir im Deutschen für die Höflichkeitsanrede die 3.PL, was sprachtypologisch übrigens sehr ungewöhnlich ist (Helmbrecht 2005, 2011). Denkense mal drüber nach, bevor Sie behaupten, im Englischen wird gesiezt: What did They do yesterday? und Ihren gegenüber meinen.
Wie würde das denn klingen, wenn Sie eine Duzbekanntschaft auf Englisch mal übel beschimpfen möchten?
Fuck thou?
PS: Also, Anatol, wie du siehst, sieze ich im Blog. Es lässt sich im Zweifelsfall leichter beleidigen.
–
Brown, Roger & Albert Gilman. 1960. The pronouns of solidarity and power. In: Sebeok, Thomas [ed]. Style in Language. MIT Press: 253–276.
Busse, Ulrich. 2002. Linguistic variation in the Shakespeare corpus — morpho-syntactic variability of second person pronouns. Benjamins.
Helmbrecht, Johannes. 2006. Typologie und Diffusion von Höflichkeitspronomina in Europa. Folia Linguistica 39(3–4): 417–452. [Link zu einer frei verfügbaren Version von 2005, Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt (18).]
Helmbrecht, Johannes. 2011. Politeness Distinctions in Pronouns. In: Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath [eds]. The World Atlas of Language Structures Online. Max Planck Digital Library, chapter 45. [Link] (06. Mai 2012).
Smith, Jeremy J. 1999. Essentials of Early English. Routledge.