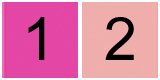Ich bin mit meiner monatlichen Würdigung der Aktion Lebendiges Deutsch und dem Wort des Monats diesmal spät dran. Die vier alten Herren haben ihre Aufgabe diesmal besser bewältigt als man es in letzter Zeit von ihnen gewohnt war. Die vorgeschlagenen Alternativen sind nicht völlig daneben und das aktuelle Suchwort ist eins, bei dem einem wenigstens nicht gleich eine offensichtliche deutsche Entsprechung in den Sinn kommt: Weiterlesen
Schlagwort-Archive: Englisch
Ein paar Krümel …
… fürs Schplock. Ich mache momentan ein Praktikum und bin kaum noch zuhause, geschweige denn in der Bibliothek, was alle laufenden Schplock-Projekte etwas verzögert.
Heute nur ein Wort, das ich bei der Arbeit aufgeschnappt habe: Brotkrumenpfad, eine direkte Übersetzung von breadcrumb trail. Was wiederum inspiriert vom deutschen Vorbild ist, auch wenn der Ausdruck im Märchen nicht auftaucht (“Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus”).
Wenn man den Kontext berücksichtigt − es ging um eine Internetseite − erschließt sich ziemlich leicht, was gemeint ist:
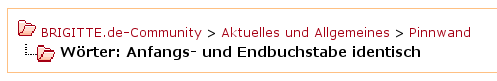 Seltsam nur, dass die Brotkrumenpfade als sinnvolle Navigation gesehen werden, im Märchen ging das ja voll daneben.
Seltsam nur, dass die Brotkrumenpfade als sinnvolle Navigation gesehen werden, im Märchen ging das ja voll daneben.
Die englische Wikipedia weiß übrigens, dass die Grimmschen Märchen auch im englischen Sprachraum nicht mehr so oft gelesen zu werden scheinen:
“Some commentators and programmers alternatively use the term “cookie crumb” (or some variant) as a synonym to describe the previously mentioned navigation technique, but this usage is considered incorrect and most likely represents a linguistic corruption of the original ‘breadcrumb’ metaphor.”
Hätten die Eltern von Hänsel und Gretel Geld für Kekse gehabt, wäre das ja alles eh nie passiert …
Das nächste Mal geht es um einen weiteren Begriff aus der Computerwelt. Aber vorher muss ich meine Kenntnisse in deutscher Wortbildung noch etwas auffrischen.
[Lesetipp] Rudi Keller über Sprachwandel
Rudi Keller, seines Zeichens Entlehner der Theorie der unsichtbaren Hand in die Linguistik, hat der Süddeutschen vor fast einem Jahr ein Interview gegeben. (Gefunden hier.) Es geht, natürlich, um Sprachwandel. Ich finde es eher so lala, vieles wird nur angerissen und bleibt dann kontextlos stehen, aber die Grundhaltung ist mir sympathisch. Nur dass er davon spricht, dass die Sick-Leser i.d.R. nicht dazu in der Lage sind, das, was sie lesen, “umzusetzen”, jagt mir einen kalten Schauer den Rücken hinunter. Herr bewahre uns!
Schade übrigens, dass bei vielen Leuten nur wenig angekommen zu sein scheint, viele Kommentare klingen so, als seien nur die Zwischenüberschriften gelesen worden …
Der angesprochene Aufsatz Kellers (von 2004) findet sich übrigens hier, darin werden fast alle im Interview angesprochenen Punkte ausführlicher behandelt, diesmal ohne die Elemente, die mir am Interview mißbehagen. Wissenschaftlich gesehen ist es Fast Food (leicht verdaulich & nichts Neues), aber als allgemeinverständliche Darstellung ist es absolut zu empfehlen.
Pink und Rosa
Gestern auf dem Spielplatz. Eine Untehaltung zwischen einem Mädchen und einem Jungen, beide etwa acht Jahre alt:
Sie: Findest du ein pinkes Fahrrad besser, oder ein rosanes?
Er: Pink ist dasselbe wie Rosa.
Sie: Äh-äh, ist es überhaupt nicht.
Er: Doch, pink ist nur das englische Wort für „Rosa“.
Sie: Ja, aber es ist trotzdem nicht dasselbe.
Er: Was ist denn der Unterschied?
Sie: Es sind zwei verschiedene Farben.
Er: Welche denn?
Sie: Pink ist so ’ne Art Neondunkelrosa. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
(Zeigt auf ihren Gürtel)
Hier, das hier ist Pink (zeigt eine Farbe, die ungefähr Bild 1 entspricht), und das hier ist Rosa (zeigt eine Farbe, die ungefähr Bild 2 entspricht).
Er: Hä? Das ist doch beides Rosa.
Dieses Gespräch (das ich hier etwas verkürzt dramatisiert wiedergegeben habe) war aus gleich drei Gründen interessant. Weiterlesen
Von Dongeln und Deppen
Wer dachte, nur die langweiligen alten Männer vom VDS würden sich über neumodische Anglizismen aufregen, hat sich getäuscht: auch die langweiligen alten Männer von der Britischen „Plain English Campaign“ regen sich über Wörter auf, die sie nicht verstehen. Und die langweiligen alten Männer von der BBC schreiben einen verwirrten Artikel darüber: Weiterlesen
Falsche Freunde und wahre Worte
 Kürzlich habe ich eine schöne Liste mit falschen Freunden aus dem Mittelhochdeutschen gefunden. “Falsche Freunde” kennt wahrscheinlich jeder aus der Schule – Wörter, die sich täuschend ähnlich sehen/täuschend ähnlich klingen, aber völlig verschiedene Bedeutungen haben. Meistens entstehen sie dadurch, dass zwei Sprachen ein und dasselbe Wort unterschiedlich behandeln – es kommt zu Bedeutungsveränderungen, die nicht parallel verlaufen. (So macht z.B. das Englische aus einem germanischen Wort etwas anderes als das Deutsche, vergleiche gift ‘Geschenk’ und Gift.) Oder aber eine Sprache entlehnt ein Wort und es bekommt eine leicht (oder radikal) andere Bedeutung. (So z.B. ein französisches Lehnwort im Deutschen.)
Kürzlich habe ich eine schöne Liste mit falschen Freunden aus dem Mittelhochdeutschen gefunden. “Falsche Freunde” kennt wahrscheinlich jeder aus der Schule – Wörter, die sich täuschend ähnlich sehen/täuschend ähnlich klingen, aber völlig verschiedene Bedeutungen haben. Meistens entstehen sie dadurch, dass zwei Sprachen ein und dasselbe Wort unterschiedlich behandeln – es kommt zu Bedeutungsveränderungen, die nicht parallel verlaufen. (So macht z.B. das Englische aus einem germanischen Wort etwas anderes als das Deutsche, vergleiche gift ‘Geschenk’ und Gift.) Oder aber eine Sprache entlehnt ein Wort und es bekommt eine leicht (oder radikal) andere Bedeutung. (So z.B. ein französisches Lehnwort im Deutschen.)
“Falsche Freunde” im Mittelhochdeutschen sind eigentlich nur die Vorgänger unser heutigen Wörter, bevor sie all die Bedeutungsverschiebungen durchgemacht haben. Die Gefahr, dass wir sie in ihrer heutigen Bedeutung verstehen ist natürlich besonders groß, weil es sich ja um eine Vorstufe des heutigen Deutschen handelt und es erstaunlich oft ganz gut klappt, die neuhochdeutsche Bedeutung zu nehmen.
Ein paar willkürliche Beispiele aus der Liste, wie immer mit einer Verneigung vor Kluges Etymologischem Wörterbuch:
Mit den Sinnen denken
Das mittelhochdeutsche betrahten ‘bedenken, erwägen, ausdenken’ bekam im Frühneuhochdeutschen den Bedeutungszusatz ‘beim Anschauen erwägen’, machte also eine Bedeutungsverengung mit. Schließlich nahm der Aspekt des Anschauens überhand, sodass betrachten heute ‘anschauen’ heißt. Das Element des Nachdenkens findet man noch im Wort Betrachtungen. Solche Bedeutungsverschiebungen passieren sehr häufig mit Wahrnehmungsverben und Verben, die kognitive Vorgänge beschreiben (begreifen und erfassen z.B. kommen aus der anderen Richtung, sie bezeichneten ursprünglich das konkrete Anfassen, beziehen sich jetzt aber auf das Verstehen).
My home is my castle
ellende ‘fremdes Land, Fremde’ ist tatsächlich der Ursprung für unser heutiges Elend. Das Wort Land steckt sogar noch drin: Im Westgermanischen gab die Bildung *alja-landja- ‘außer Landes seiend’. Im Althochdeutschen fällt der Umlaut über das Wort her und macht elilenti daraus.1
Im Ausland zu sein war einstens kein Spaß, meist war man da, weil man verbannt war – und so kam es, dass das Wort die Bedeutung ‘Unglück, Jammer’ annahm. Es hat also eine Bedeutungsverschlechterung mitgemacht.
Das ist nicht witzig!
Das Wort witze heißt im Mittelhochdeutschen ‘Wissen, Verstand, Besinnung, Einsicht, Klugheit, Weisheit’. Es ist eine Ableitung von wissen. Im 17. Jahrhundert hat das französische Wort esprit auf den Witz eingewirkt, das sich in der Bedeutung mit ihm überschnitt, aber zusätzlich das ‘geistreiche’ Element besaß. (Das nennt man Lehnbedeutung: Ein vorhandenes Wort entlehnt eine Bedeutung von einem Wort aus einer anderen Sprache.) So bekam Witz bald die Bedeutung ‘geistreiche Formulierung’ und im 18. Jahrhundert mussten Witze nicht mehr geistreich sein, das Wort hieß nur noch ‘Scherz’. So kann der Intellekt in den Schmutz gezogen werden … der Untergang des Abendlandes ist nahe …
Beitragsaufrufe und Auswahlfragen
Sprachblogleser/innen der ersten Stunde erinnern sich vielleicht, dass ich der „Aktion Lebendiges Deutsch“ gegenüber anfänglich eigentlich positiv eingestellt war. Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich Lehnwörter daraufhin anzusehen, ob es im Deutschen nicht bereits eine konventionelle Alternative gibt oder ob man nicht mit Hilfe produktiver Wortbildungsmechanismen eine Alternative aus dem bestehenden Wortschatz zusammenbauen könnte. Ob die sich dann durchsetzt oder ob die Sprachgemeinschaft aus welchen Gründen auch immer — und es gibt oft gute Gründe — beim Lehnwort bleibt, kann man dann getrost dem evolutionären Prozess überlassen, durch den eine Sprache sich ständig verändert und neuen Gegebenheiten anpasst. Weiterlesen
[Ostern] Ostern
Ostern ist nicht nur etymologisch interessant, sondern auch vom Wortmaterial her: Es gab einmal einen Singular, die Oster, heute ist aber nur noch der Plural Ostern gebräuchlich. Den man gelegentlich auch wieder als Singular verwenden kann: das Ostern.

Ostern 1987 – noch kein Interesse an Etymologien
Woher das Wort kommt, ist nicht so eindeutig. Es ist auf jeden Fall verwandt mit Osten als dem Ursprung der Sonne und bezieht sich wahrscheinlich auf eine vorchristliche Gottheit der Morgenröte, auf jeden Fall aber auf das Längerwerden der Tage und den Frühling. Morgenröte, Auferstehung, der Weg war nicht weit und die Übertragung auf das christliche Fest schnell erledigt. Im Althochdeutschen hieß das Fest ôst(a)râ, im Mittelhochdeutschen ôster. Der Monat April hieß übrigens früher einmal ôstermânôth, angeblich so benannt durch Karl den Großen. (Zu den Monatsnamen auch: Wunderland Deutsch.)
Die europäischen Sprachen sind, was Ostern angeht, nicht so variantenreich:
- Das Englische hält es mit dem Deutschen (Easter).
- Die meisten Sprachen haben aus dem Hebräischen/Aramäischen entlehnt (ich zitiere keine Urform, da ich keine zuverlässige Quelle habe), und zwar die Bezeichnung des jüdischen Pessach-Festes, mit dem Ostern nicht von ungefähr zeitlich und kausal in Bezug steht: Dänisch (Påske), Spanisch (Pascua), Finnisch (Pääsiäinen), Französisch (Pâques), Italienisch (Pasqua), Niederländisch (Pasen), Norwegisch (Påske), Rumänisch (Paşti), Russisch (Пасха), Schwedisch (Påsk)
- Ungarisch (Húsvét): hús heißt auf jeden Fall ‘Fleisch’, die Zusammensetzung wahrscheinlich ‘Fleisch nehmen/kaufen’, aber die Bedeutung stammt nur aus dem Internet, also wer weiß. Wäre aber logisch, die Fastenzeit ist da nämlich vorbei.
- Mit Bezug auf die Nacht, wie an Weihnachten auch, gibt es ‘große Nacht’ im Polnischen (Wielkanoc) und Tschechischen (Velikonoce). Im Lettischen (Lieldienas) ist hingegen der Tag groß.
Hier gibt es übrigens eine ganze Sammlung von Osterbezeichnungen in verschiedenen Sprachen.
[Ostern] Karfreitag
Hier haben wir doch noch einen Tag, der den Kummer ausdrückt, mit dem es am Gründonnerstag nichts wurde. Kar- geht auf althochdeutsch kara ‘Kummer, Sorge’ zurück (übrigens verwandt mit dem englischen care). Ein Blick in Grimms Wörterbuch zeigt aber, dass das Wort Kartag ursprünglich nicht allgemein einen traurigen Tag bezeichnete, sondern einen ganz bestimmten traurigen Tag: den “tag an welchem ein verstorbener unter klaggeschrei beerdigt und dann das leichenmahl gehalten wird” (DWB). Im Zimbrischen, einer deutschen Sprachinsel in Italien, hat es diese Bedeutung noch heute.
Der Karfreitag ist also einfach der Tag, an dem Jesus dem christlichen Glauben nach starb und prompt beerdigt wurde. Im Mittelhochdeutschen hieß der Tag karvrîtac oder schlicht kartac.
Auch heute habe ich mich ein bißchen im restlichen Europa umgesehen:
- ‘heiliger Freitag’: Spanisch (Viernes Santo), Französisch (Vendredi saint), Italienisch (Venerdì Santo)
- ‘guter Freitag’: Niederländisch (Goede Vrijdag), Englisch (Good Friday) – Zumindest im Englischen kommt es von der ursprünglichen Bedeutung ‘heilig’.
- ‘großer Freitag’: Russisch (Великая пятница), Tschechisch (Velký pátek), Polnisch (Wielki Piątek), Ungarisch (Nagypéntek), Estnisch (Suur reede), Rumänisch (Vinerea Mare)
- ‘Leidensfreitag’: Rumänisch (Vinerea Patimilor)
- ‘langer Freitag’: Schwedisch (Långfredagen), Dänisch (Langfredag), Norwegisch (Langfredag), Finnisch (Pitkäperjantai) – Im Englischen scheint es auch einmal einen Long Friday gegeben zu haben, “due to the long fast imposed upon this day”. Ob das die richtige Etymologie ist, weiß ich allerdings nicht.
Hat tip to … & Stephen Fry
Oft findet man am Ende eines englischsprachigen Blogeintrags die Wendung “Hat tip to NAME”. Sie dient dazu, darauf hinzuweisen, dass das Gepostete (Link, Video, Nachricht, Bild …) in einem anderen Blog gefunden wurde oder man einen Hinweis darauf per Mail/in den Kommentaren/… bekommen hat. Es ist also eine Art von Urheberhinweis, auch wenn er eher auf FinderInnen denn auf wirkliche UrheberInnen verweist. Oft wird der “Hat tip” aber auch einfach als Dank verwendet.
Ein paar Beispiele:
- Für einen Comicstrip: “Hat tip to Greg Poulos.” (Language Log)
- Für eine technische Erklärung: “Hat tip to problogdesign.com for spelling this method out so clearly!” (Smitten Kitchen)
- Für ein Foto: “Hat tip to Eric Kinzel” (Language Log)
- Für eine Nachricht: “hat-tip Matt Wedel again” (Tetrapod Zoology)
- Für einen Aufsatz: “hat tip to Marilyn Martin” (Language Log)
Und woher kommt der Ausdruck? Vom Grüßen indem man einen Finger an die Hutkrempe legt. Von da aus ging’s wohl vom reinen Gruß zur Anerkennung zum Dank.
Und im Deutschen? Wir haben zwar Den Hut vor jemandem ziehen, aber das passt nicht wirklich auf solche Situationen, weil es einfach zu viel Ehrerbietung und Respekt ausdrückt. Soooo viel haben die HinweisgeberInnen jetzt auch nicht geleistet.
Bei Leserhinweisen lässt sich das meist recht gut regeln mit “Danke für den Link/Hinweis/… an NAME” o.ä.:
- Mit Dank an Lisa A. (BILDBlog)
Was ist aber mit Hinweisen aus anderen Blogs, die man selbst gefunden hat – dafür kann man sich doch nicht wirklich bei der Person bedanken? Das klingt ja dann, als wäre sie aktiv auf einen zugekommen?
Ein bißchen Googlen zeigt, dass der Hat tip ganz gerne übernommen wird:
- Hat tip to Neuroskeptic: Ein satirischer Seitenhieb auf die Verhaltensneurobiologie. (Varia & Eventualia)
- Und Hat Tip an Christian Butterbach für den Hinweis auf diesen erfrischenden Post! (Eine neue Freiheit)
Eine etwas nüchterne Alternative habe ich auch gefunden, ganz ohne das dankende Element:
- [via Indecision Forever] (Stefan Niggemeier)
Leider ist es recht schwer, nach Hat tips zu googlen, die Hat tip nicht verwenden. Falls also jemand Hinweise hat … ich werde auch weiter ergänzen, falls ich noch andere Formulierungen finde.
So. Und wie kam ich drauf? Genau: Ich wollte ein Video posten, in dem Stephen Fry über Sprache spricht. (Mal wieder.) Und dabei nicht unterschlagen, dass ich es nicht selbst gefunden habe, sondern in der Linksammlung des Bremer Sprachblogs, wo es “Zetterberg” gepostet hat:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wzMIKsrjcOI&hl=de&fs=1&rel=0]
(Im vorhergehenden Teil geht’s um andere Dinge.)