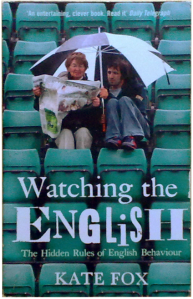Buchtipps sind keine Spezialität von mir. Nicht, dass ich nicht einen ganzen Stapel von empfehlenswerten Büchern auf meinem Nachttisch liegen hätte. Aber irgendwie kann ich mich nur selten davon überzeugen, was drüber zu schreiben. Und wenn ich’s dann tue, sind es schon alte Hüte. Jetzt will ich die Zahl der dringend nötigen Tipps auf drei verringern:
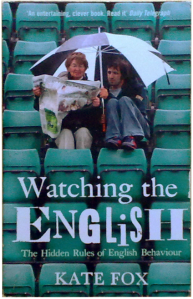 “Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour” habe ich vor einigen Jahren gelesen und mittlerweile ist seine große Zeit in den deutschen Bahnhofsbuchhandlungen (denn da steht es eigentlich in jeder größeren Stadt) schon fast wieder vorüber. Als ich es meiner Mutter schenkte, hatte sie es sich schon selbst gekauft. Als ich es Memo empfehlen wollte, kannte er es schon längst. Ihr müsst es also lesen, Gruppenzwang und so! Aber ganz abgesehen davon, ist es wirklich großartig.
“Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour” habe ich vor einigen Jahren gelesen und mittlerweile ist seine große Zeit in den deutschen Bahnhofsbuchhandlungen (denn da steht es eigentlich in jeder größeren Stadt) schon fast wieder vorüber. Als ich es meiner Mutter schenkte, hatte sie es sich schon selbst gekauft. Als ich es Memo empfehlen wollte, kannte er es schon längst. Ihr müsst es also lesen, Gruppenzwang und so! Aber ganz abgesehen davon, ist es wirklich großartig.
Kate Fox ist eine britische Anthropologin, die sich einem skurrilen Inselvolk widmet: Den Engländern. Sie analysiert das Volk mit dem Beschreibungsinstrumentar ihres Faches und schafft es dabei, uns die Engländer zunächst völlig zu entfremden und sie uns dann wieder sehr nahe zu bringen. Man sollte das Buch keinesfalls zu kurz vor einer Reise auf die Insel lesen – die daraus entstehende Angst davor, all diese geheimnisvollen gesellschaftlichen Regeln zu brechen, kann in enormem Stress resultieren.
Warum ich “Watching the English” so fantastisch finde? Es ist wissenschaftlich fundiert – aber nicht vollgestopft mit unverständlicher Terminologie. Kate Fox erklärt genau, wie sie arbeitet und warum sie es so tut. Es ist lebendig – zur Illustation dienen oft mitgehörte Gespräche oder selbst gemachte Beobachtungen, aber auch kleine Anekdoten. Es ist humorvoll – nicht zum Brüllen komisch, aber auf eine sehr feine, schmunzelnde Art humorvoll. Kate Fox nimmt ihre Arbeit ernst, kann aber auch wunderbar selbstironisch sein.
Das Buch besteht aus zwei Teilen, “Conversation Codes” und “Behaviour Codes”. Im ersten Teil geht es um schplockrelevantes, nämlich Sprache und Kommunikation. Dabei kommt natürlich das beliebte Wetter zur Sprache, aber es geht auch darum, wie ein Gespräch zwischen zwei Unbekannten verläuft, in welchem Verhältnis Sprache und Klasse zueinander stehen und welche Besonderheiten in einem Pub zu beobachten und ‑lauschen sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man sich beim Kennenlernen nie direkt mit Name und Beruf vorstellt? Der Name wird erst ganz am Schluss und ganz beiläufig genannt, den Beruf lässt man sein Gegenüber erraten.
Der zweite Teil widmet sich verschiedenen Lebensbereichen und ihnen eigenen Verhaltensmustern. Es wird erklärt, warum my home my castle ist, es geht um Arbeit, Freizeit, Kleidung und vieles mehr. Auch die enorme Bedeutung des Schlangebildens wird unter die Lupe genommen: Engländer stellen sich überall an und halten die Reihenfolge penibel ein. Selbst wenn sie ganz alleine sind.
Alle “Regeln” arbeitet Fox durch Beobachtungen, Interviews und auch kleine Experimente heraus – sie bricht sie und analysiert die Reaktionen darauf. Diese Regeln fügen sich nachher zu etwas zusammen, das sie “the Grammar of Englishness” nennt, ein Regelwerk, das von einigen wenigen Prinzipien bestimmt wird und alle Verhaltensmuster auf ein gemeinsames Grundmuster zurückführt.
“Watching the English” gibt es – das Thema legt es nahe – nur auf Englisch. Wer von Euch davon genug zum Bücherlesen kann, dem sei es allerwärmstens ans Herz gelegt!
Hier noch eine der kleinen Regeln zum Reinschnuppern:
The Weather-as-family Rule
While we may spend much of our time moaning about our weather, foreigners are not allowed to criticize it. In this respect, we treat the English weather like a member of our family: one can complain about the behaviour of one’s own children or parents, but any hint of censure from an outsider is unacceptable, and very bad manners.
Although we are aware of the relatively undramatic nature of the English weather – the lack of extreme temperatures, monsoons, tempests, tornadoes and blizzards – we become extremely touchy and defensive at any suggestion that our weather is therefore inferior or uninteresting. […] Indeed, the weather may be one of the few things about which the English are still unselfconsciously and unashamedly patriotic.
 Das Althochdeutsche wird für die Zeit zwischen 500 und 1050 nach Christus angesetzt, also für rund 550 Jahre. Das ist eine Menge Zeit, man kann sich also schon denken, dass man da nur schwer von einer einheitlichen Sprache ausgehen kann.
Das Althochdeutsche wird für die Zeit zwischen 500 und 1050 nach Christus angesetzt, also für rund 550 Jahre. Das ist eine Menge Zeit, man kann sich also schon denken, dass man da nur schwer von einer einheitlichen Sprache ausgehen kann.