[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_s-u3ZN_YXs&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1]
Bei Youtube gibt es höchst skurrile Etymologie-Videos in Kombination mit grauenvollem Akzent und viel nackter Haut — Sprachwissenschaft mal anders:
http://www.youtube.com/user/hotforwords
Archiv der Kategorie: Schplock
Pirahã vs. Chomsky
Im New Yorker gab es im April eine lange Reportage von John Colapinto: The Interpreter.
Darin geht es um Dan Everett — einen Missionar der zum Linguisten wurde, die Pirahã — ein Amazonasvolk, das nichts von der Außenwelt hält — und ihre Sprache — mit der sich Chomsky nicht vereinbaren lässt.
Eine angenehm lesbare Zusammenfassung!
Und noch ein Zitat von Michael Tomasello:
“Universal grammar was a good try, and it really was not so implausible at the time it was proposed, but since then we have learned a lot about many different languages, and they simply do not fit one universal cookie cutter.”
Mischievous Michif
Ich lese spannende Bücher und muss dringend erzählen, was drin steht!
Aber erst die Quelle:
Peter Bakker (1997): A Language of Our Own. The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Métis. New York, Oxford.
Michif ist eine Sprache, die aus zwei Sprachen besteht, die sich auf sehr ungewöhnliche Weise miteinander verbunden haben — nämlich fein säuberlich.
Lexik
Die eine Hälfte (Verben, Demonstrativa) ist Plains Cree, die andere (Nomen, Adpositionen, Personalpronomen, Numeralien) ist Französisch. Adjektive, Adverbien, Quantifikatoren und andere Funktionswörter können aus beiden Sprachen stammen.
Phonologie
Es gibt zwei verschiedene Phonemsysteme in Michif — selbst wenn ein Phonem in beiden Teilen vorkommt, hat es immer noch verschiedene Allophone. Nur im frz. Teil hat sich eine Art Vokalharmonie entwickelt (die es natürlich im “richtigen” Französisch nicht gibt, aber vielleicht in dem frz. Dialekt der als Basis für Michif diente, das ist noch nicht erforscht). Die beiden Systeme beeinflussen sich also nicht gegenseitig — mit einer klitzekleinen Ausnahme, nämlich der Cree-Betonung, die den frz. Teil in einigen Fällen (drei- oder mehrsilbige Wörter) beeinflusst.
Syntax
Die Wortstellung ist wie im Cree, nämlich sehr frei. Innerhalb der Nominalphrase ist sie wie im Französischen.
Die Kongruenzsysteme der beiden Sprachen verbinden sich — im frz. Teil maskulin/feminin in der NP, im Cree belebt/unbelebt — die frz. Nomen werden also als belebt oder unbelebt klassifiziert und entsprechend kongruiert dann das Cree-Verb.
Morphologie
Manchmal können frz. Wörter Cree-Affixe haben, aber das kommt eher selten vor.
Und wer macht sowas?
Gesprochen wird Michif von den Métis in Kanada und Nordamerika, ein Volk, das sich ebenso fein säuberlich verbunden hat: Die Männer waren europäische Pelzhändler, die Frauen Cree-Indianerinnen. Heute gibt es weniger als 1000 Sprecherinnen und Sprecher, zu Spitzenzeiten waren es aber auch nur maximal 3000. Die meisten von ihnen sprechen weder Französisch noch Cree.
Das Buch von Bakker hat sich zum Ziel gesetzt, herauszubekommen, wie es zu dieser ungewöhnlichen Mischung kam. Bisher hat er allerdings nur Hypothesen verworfen, die eh nicht ernstzunehmen waren, ich warte noch auf die magische Lösung … wenn die kommt, sage ich natürlich Bescheid, und ich suche auch noch ein paar schöne Beispielsätze aus!
Update:
Ich habe natürlich schon lange herausgefunden, was Bakker denkt, auch wenn ich das Buch leider nicht zu Ende lesen konnte. Uuuuuund zwar:
Es handelt sich um ein absichtlich geschaffenes Phänomen, um die neue kulturelle Identität der Métis zu stärken. Das denkt auch Sarah Grey Thomason, ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich es so plausibel finde. Sollte ich mal wieder in die Nähe des Bakker-Buches kommen, lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren.
Oh, und der versprochene Beispielsatz:
æ be:bi la præses ki:-aja:w‑e:w
ART:Sg. Baby ART:Sg. Prinzessin PRÄT-haben-TRANS.ANIM.3.>3.Sg.
‘Die Prinzessin hatte ein Kind.’
(Bakker/Papen 1997:336)
Der Mai ist gekommen
James D. McCawleys Dates in the Month of May that Are of Interest to Linguists sollte man in der Linguistik-Einführung lernen …
Guten Morgen, Guten Tag …
Ich lese grade in einer Kolumnensammlung der Japan Times namens Nihongo Notes (Osamu & Nobuko Mizutani) in mehreren Bänden (eher Bänd-chen) aus den 70ern/80ern. Es geht quasi darum, arme Ausländer im höflichkeitssensiblen Japan vor sozialer Ausgrenzung und Ächtung wegen Verwendung falscher Ausdrücke zu bewahren.
In Deutschland sind die Bücher wohl nur noch antiquarisch und zu horrenden Preisen zu bekommen (die phantasievollste Preisforderung will pro Seite einen Euro), großes Buh!
Was mich sehr fasziniert hat (Erkennen, Eigenes, Fremdes etc.):
お早う ohayou heißt ‘Guten Morgen!’ und 今日は konnichiwa ‘Guten Tag!’ Mit großer Mühe und viel Liebe wird den Japanischlernenden nun nahegebracht, dass es nicht nur an der Tageszeit liegt, welchen Gruß man benutzt, sondern auch an der Beziehung, in der man zu jemandem steht. Ohayou verwendet man generell morgens, sowohl der eigenen Gruppe (Familie, Freunde, Kolleginnen) als auch Fremden gegenüber. Sollte es sich aber einmal zutragen, dass man z.B. erst mittags zur Arbeit kommt, dann darf man niiiiiiiiemals konnichiwa sagen, denn das ist ein Gruß, den man Leuten gegenüber verwendet, die nicht zum engeren Umfeld gehören.
So weit, so gut, ominöse Japaner … aaaaaaber dann ist mir aufgefallen: Wir machen es auch nicht anders! (Guten) Tag! ist auch bei uns sehr an die Vertrautheit gekoppelt — man würde es nie zur eigenen Familie oder zu Freunden sagen, da klingt es viel zu formell.
今晩は konbanwa bzw. Guten Abend verhält sich wie konnichiwa/Guten Tag!
Und die Gute Nacht! finde ich leider nicht mehr, ich bin mir sicher, dass irgendwo etwas dazu stand, aber mein Lesezeichensystem weist ernsthafte konzeptionelle Fehler auf.
Dennoch wünsche ich sie hiermit: お休みなさい oyasuminasai!
[Bilderbuchtipp] Windows Vista = ‘Windaugensicht’
Oooh, oooh, ganz dringend lesen:
Wolfgang Viereck, Karin Viereck, Heinrich Ramisch (2002): dtv-Atlas Englische Sprache. München.
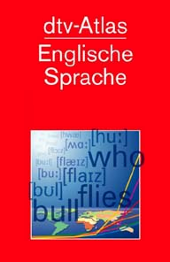 Da erfährt man zum Beispiel, dass window ein skandinavisches Lehnwort ist und ursprünglich ‘Windauge’ hieß. Oder dass die Pikten von den Römern so genannt wurden, weil sie picti ‘Bemalte’ waren. Oder dass Professor Slughorn eine Nacktschnecke beinhaltet, und keine mit Häuschen, denn die heißt ja snail (*summ* “I’d rather be a sparrow than a snail …”). – Und auch wenn man Englisch studiert oder so etwas aus anderen Gründen für Allgemeinwissen hält, wird man bestimmt seine Freude dran haben.
Da erfährt man zum Beispiel, dass window ein skandinavisches Lehnwort ist und ursprünglich ‘Windauge’ hieß. Oder dass die Pikten von den Römern so genannt wurden, weil sie picti ‘Bemalte’ waren. Oder dass Professor Slughorn eine Nacktschnecke beinhaltet, und keine mit Häuschen, denn die heißt ja snail (*summ* “I’d rather be a sparrow than a snail …”). – Und auch wenn man Englisch studiert oder so etwas aus anderen Gründen für Allgemeinwissen hält, wird man bestimmt seine Freude dran haben.
Außerdem hat es ein Text-Bild-Verhältnis von 50:50! Juhu!
Auf dem Gartenweg
“Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.”
(Groucho Marx)
Garden-path sentences heißen auf Niederländisch intuinzin [ɪn tœyn zɪn] ‘im Garten Satz’ — ein Ausdruck, der für Deutsche wiederum ein Zungenbrecher (tongbreker) ist. Mein liebstes Niederländischwörterbuch kennt das Wort aber leider nicht. Dennoch sei es empfohlen: www.uitmuntend.de
Sprache vs. Dialekt
.אַ שפראַך איז אַ דיאַלעקט מיט אַן אַרמײ און פֿלאָט
A shprakh iz a dialekt mit an armey un flot.
(Max Weinreich, 1945)
Nun hat Jiddisch weder das eine, noch das andere.
Außerdem hat es (teilweise abgewandelte) hebräische Buchstaben, wie man oben sehen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass es so schwer zu lesen ist wie Hebräisch — man schreibt nämlich auch die Vokale.
Schon ziemlich lange übrigens: Dukus Horant — eine Art altjiddische Kudrun.
Schplock-Literaturverzeichnis
Alte Schplock-Beiträge (bis Ende 2010) wurden noch nicht mit individuellen Literaturverweisen versehen, sondern besaßen ein gemeinsames Literaturverzeichnis. Der Vollständigkeit halber ist es in diesem rückdatierten Beitrag zu finden:
Achilles, Ilse und Gerda Pighin (2008): Vernäht und zugeflixt! Von Versprechern, Flüchen, Dialekten & Co. Mannheim.
[27.3.09]
Bakker, Peter (1997): A Language of Our Own. The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Métis. New York, Oxford.
[22.8.07]
Bakker, Peter & Robert Papen (1997): Michif. A Mixed Language Based on French and Cree. In: Sarah Grey Thomason: Contact languages. A wider perspective. Amsterdam. 295–365.
[22.8.07, Update]
Bergmann, Rolf, Peter Pauly & Claudine Moulin-Fankhänel (2007): Alt- und Mittelhochdeutsch. Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte. 7. Aufl. Göttingen.
[28.7.09]
Besch, Werner & Heinrich Löffler (1977): Alemannisch. Dialekt/Hochsprache kontrastiv. Sprachhefte für den Unterricht. Düssendorf.
[23.4.09]
Christen, Helen (2001): Ein Dialektmarker auf Erfolgskurs: Die /l/-Vokalisierung in der deutschsprachigen Schweiz. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 1, 16–26.
[13.8.10]
Colapinto, John (2007): The Interpreter. Has a remote Amazonian tribe upended our understanding of language? In: The New Yorker, 16.4.2007.
[9.10.07]
Comrie, Bernard (2008): Numeral Bases. In: Haspelmath, Martin & Dryer, Matthew S. & Gil, David & Comrie, Bernard (Hgg.) The World Atlas of Language Structures Online. Kapitel 131. München.
[9.7.10]
Dudenredaktion (2005): Die Grammatik. Bd. 4. 7. Aufl. Mannheim u.a.
[16.1.09, 25.2.09]
Ernst, T. & E. Smith (1978): Lingua Pranca. An Anthology of Linguistic Humor. Bloomington.
[12.8.07]
Foljanty, Detlef (1984): Die japanische Schrift. In: Tohru Kaneko & Gerhard Stickel: Deutsch und Japanisch im Kontrast. Bd. 4. Japanische Schrift, Lautstrukturen, Wortbildung. Heidelberg. 30–63.
[9.7.09]
Foljanty, Detlef (1985): Japanisch intensiv. Ein Lernbuch mit Lösungen. 2. Aufl. Hamburg.
[9.7.09]
Frank, M. C. et al. (2008): Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and cognition. In: Cognition 108, 3.
[9.7.2010]
Gil, David (2008): Para-Linguistic Usages of Clicks. In: Haspelmath, Martin et al. (Hgg.): The World Atlas of Language Structures Online. Munich. Chapter 142.
[25.6.08]
Grimm, Jacob und Wilhelm (1854–1960): Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig.
[22.12.08, 20.2.09, 24.2.09, 25.2.09, 12.3.09, 23.3.09, 1.4.09, 9.4.09, 10.4.09, 13.5.09, 1.6.09]
Haas, Walter (1983): Vokalisierung in den deutschen Dialekten. In: Besch, Werner et al.: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung, 2, 1111–1116. Berlin, New York.
[13.8.10]
Hall, Tracy Alan (2000): Phonologie. Eine Einführung. Berlin, New York.
[2.3.09]
Herrgen, Joachim (1986): Koronalisierung und Hyperkorrektion. Das palatale Allophon des /ch/-Phonems und seine Variation im Westmitteldeutschen. Stuttgart.
[4.3.09, 6.3.09]
Heuser, Rita (2008): Namen der Mainzer Straßen und Örtlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und motivgeschichtliche Auswertung. Stuttgart.
[7.10.09]
Hoppmann, Dorothea (2007): Einführung in die koreanische Sprache. Hamburg.
[17.9.09]
Jones, Steve & Borin Van Loon (1994): Introducing Genetics. Cambridge.
[6.8.07]
König, Werner (1989): Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland. 2 Bde. Ismaning.
[4.3.09]
König, Werner (2005): dtv-Atlas Deutsche Sprache. 15. Aufl. München.
[21.7.09, 28.7.09]
Kürschner, Sebastian (2005): Verfugung-s-nutzung kontrastiv. Zur Funktion der Fugenelemente im Deutschen und Dänischen. In: TijdSchrift voor Skandinavistiek. 26, 2. 103–125.
[25.2.09]
Kunze, Konrad (2004): dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. 5. Aufl. München.
[13.8.09]
Kurz, Gebhard und Günter Wojaczek (2002): Studium Latinum. Latein für Universitätskurse. Teil 2: Übersetzungshilfen und Grammatik. 3. Aufl. Bamberg.
[9.4.09]
Lexer, Matthias (1992): Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Zugleich als Supplement und alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke. Nachdruck der Ausg. Leipzig 1872–1878 mit einer Einleitung von Kurt Gärtner. 3 Bde. Stuttgart.
[23.3.09]
Martin, Ernst und Hans Lienhart (1899–1907): Wörterbuch der elsässischen Mundarten. 2 Bde. Straßburg. [Nachdruck Berlin/New York 1974].
[15.4.09]
Meibauer, Jörg et al. (2002): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart, Weimar.
[9.1.09, 4.10.09]
Meibauer, Jörg (2003): Phrasenkomposita zwischen Wortsyntax und Lexikon. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 22, 153–188.
[4.10.09]
Mizutani, Osamu & Nobuko (1977): Nihongo Notes 1. Speaking and Living in Japan. Tokyo.
[12.8.07]
Müller, Ernst Erhard (1979): Großvater, Enkel, Schwiegersohn. Untersuchungen zur Geschichte der Verwandtschaftsbezeichnungen im Deutschen. Heidelberg.
[2.4.09]
Nübling, Damaris et al. (2006): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen.
[20.3.09, 23.3.09, 1.5.09]
Ochs, Ernst (Bearb., 1925–1940): Badisches Wörterbuch. Bd. 1. Lahr.
[30.11.10]
Olschansky, Heike (1999): Täuschende Wörter. Kleines Lexikon der Volksetymologien. Stuttgart.
[25.12.08, 23.3.09, 13.8.09]
Paul, Hermann & Walther Mitzka (1960): Mittelhochdeutsche Grammatik. 18. Aufl. Tübingen.
[24.8.09]
Reyzl, Marion (2000): Die Geschichte der deutschen Verwandtschaftsbezeichnungen vom Althochdeutschen bis ins 20. Jahrhundert. Blutsverwandtschaft und Heiratsverwandtschaft. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität Eichstätt.
[20.3.09]
Rymer, Russ (1994): Genie. A Scientific Tragedy. New York.
[6.8.07]
Sanders, Willy (1982): Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch. Sprachgeschichtliche Grundzüge des Niederdeutschen. Göttingen.
[21.7.09]
Schirmunski, Viktor M. (1962): Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten. Berlin.
[6.6.09, 6.7.10]
Schoof, Wilhelm (1900): Die deutschen Verwandtschaftsnamen. In: Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten 1. 193–298.
[20.3.09]
Seebold, Elmar (2002): Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Aufl. Berlin.
[25.12.08, 27.12.08, 20.2.09, 24.2.09, 26.2.09, 12.3.09, 23.3.09, 9.4.09, 10.4.09, 29.4.09, 13.5.09, 1.6.09, 4.9.09, 30.11.10]
Stellmacher, Dieter (1990): Niederdeutsche Sprache. Eine Einführung. Bern u.a.
[21.7.09]
Schweikle, Günther (2002): Germanisch-deutsche Sprachgeschichte. 5. Aufl. Stuttgart u.a.
[28.7.09]
Thomason, Sarah Grey (2003): Contact as a Source of Language Change. In: Brian D. Joseph & Richard D. Janda (Hg.): The Handbook of Historical Linguistics. Malden. 687–712.
[22.8.07, Update]
Tomasello, Michael (2005): Commentary on D. Everett — The Grammar of the Piraha. In: Current Anthropology, 46,4. 640 — 641.
[9.10.07]
Tschenkéli, Kita (1958): Einführung in die georgische Sprache. Band I: Theoretischer Teil. Zürich.
[20.2.10]
Veith, Werner (1987): Kleiner deutscher Sprachatlas. Bd. 1.2: Konsonantismus. Frikative, Sonanten und Zusatzkonsonanten. Tübingen.
[4.3.09]
Viereck, Wolfgang, Karin Viereck & Heinrich Ramisch (2002): dtv-Atlas Englische Sprache. München.
[12.8.07, 2.6.09]
Weinrich, Harald, Maria Thurmair, Eva Breindl & Eva-Maria Willkop (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. 2. Aufl. Hildesheim u.a.
[13.5.09]
Windschuttle, Kevin (2004): A Disgraceful Career. In: The New Criterion 23,1.
[10.2.08]
