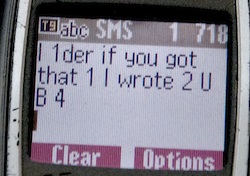Ich habe lange nichts über den Verein Deutsche Sprache geschrieben, dabei hätte der etwas digitale Aufmerksamkeit dringend nötig: Für den Suchbegriff VDS bietet Google derzeit als ersten Treffer die Seite des Brandschutzexperten „Vertrauen durch Sicherheit“ an, erst an zweiter Stelle folgen die Anglizismenjäger aus Dortmund. Der Suchbegriff Sprachnörgler führt dagegen nach wie vor treffsicher zum gewünschten Ziel.
Da ich persönlich die Hauptverantwortung für die Verbreitung dieses Begriffs trage (wobei ich seinerzeit Schützenhilfe von Wortistiker Detlef Gürtler hatte), würde ich zum Ausgleich gerne etwas Nettes über den VDS sagen. Aber so sehr ich mich bemühe, in den Pressemitteilungen der Möchtegern-Sprachschützer irgendetwas zu finden, das tatsächlich etwas mit Sprachpflege zu tun hätte, ich finde immer nur Sprachnörgeleien, die in ihrer humorbefreiten Blödhaftigkeit zum Verzweifeln sind.