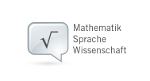Im Language Log, der Mutter aller Sprachblogs, kämpft man seit vielen Jahren gegen den Mythos von den vielen (50, 100, 200, 500, …) Eskimo-Wörtern für Schnee, den ich im Bremer Sprachblog auch schon ein paar Mal behandelt habe. Obwohl die Kollegen in Dutzenden von Beiträgen versucht haben, den Mythos zu entkräften, findet sich fast jede Woche jemand, der ihn an sichtbarer Stelle in den Medien wiederholt.
Es ist deshalb sicher verständlich, dass die Autoren des Language Log mittlerweile auf die bloße Erwähnung von Schneevokabular gereizt reagieren. Trotzdem finde ich, dass Language Logger Ben Zimmer in seinem jüngsten Beitrag zum Thema etwas überempfindlich wirkt. Thema des Beitrags ist folgendes Werbeplakat des isländischen Bekleidungsherstellers 66° North: